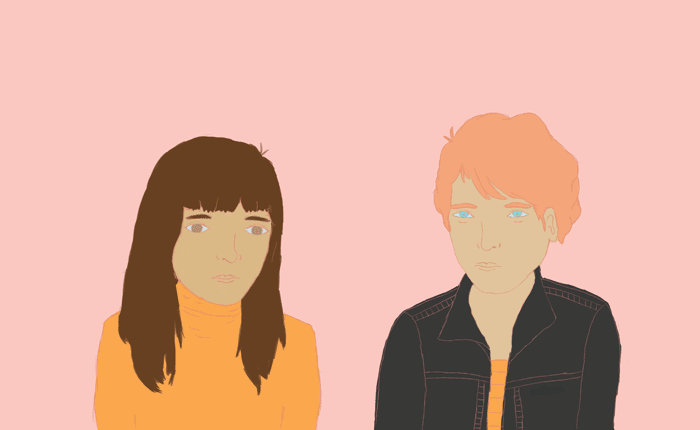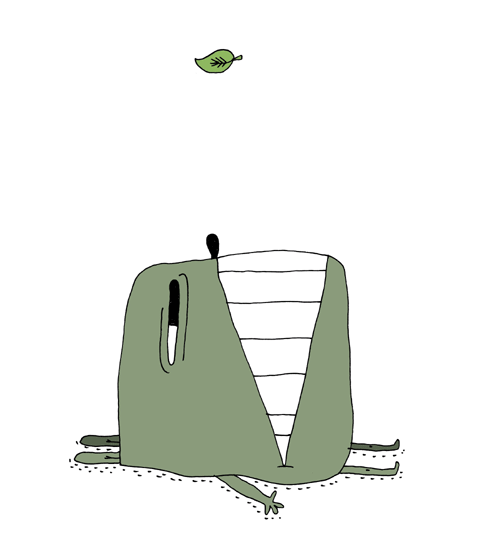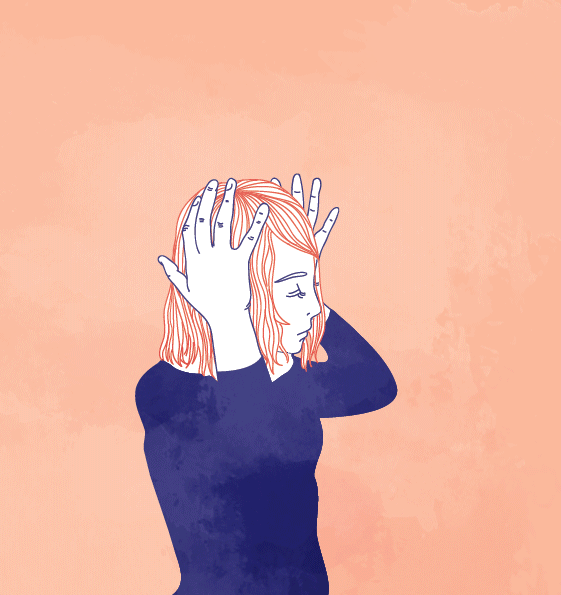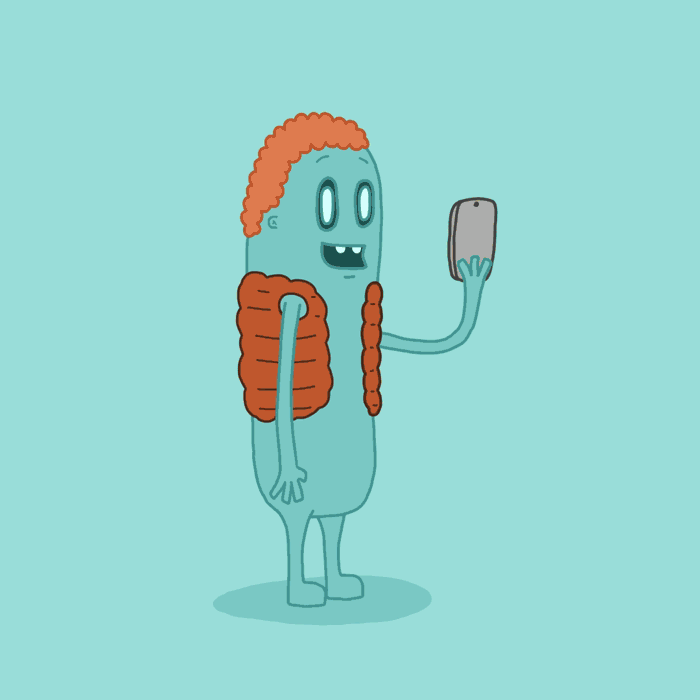Nein, danke! Echt lieb von dir. Aber spar dir die Zeit, die Nerven und das Geld für mein Weihnachtsgeschenk. Wieso?
Deswegen: Du überlegst dir ab November schon: «Was soll ich dem Lorenz eigentlich schenken?». Dieser Gedanke belagert und quält dich bis zum 24. Dezember. Dann musst du – aus deiner Sicht notgedrungen – etwas kaufen.
Du gräbst dich also zielstrebig und entschlossen durch die Menschenmassen der Stadt auf der Suche nach einem passenden Geschenk.
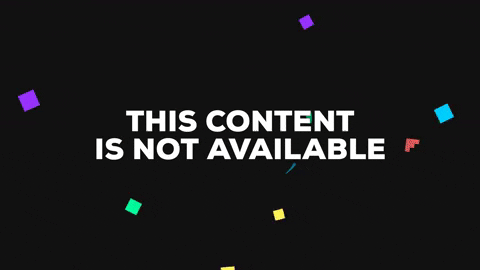
In einem überteuerten Pop-up-Store dann die Erlösung: Du siehst einen japanischen Roboter aus den 80ern zum selber Zusammensetzen und biegst dir meine Vorlieben so lange zurecht, bis du mich und den japanischen Roboter aus den 80ern zum selber Zusammensetzen als Super-Match erachtest.
Du blätterst unverhältnismässige 120 Franken auf den Tisch, läufst aber mit einem guten Gefühl der Erlösung aus dem Laden und fügst dich wieder in den Geschenke kaufenden Menschenstrom ein, der durch die Innenstadt fliesst.
Dilemma an der Weihnachtsfeier
Schnitt zur Weihnachtsfeier am 25. 12. leicht ausgepowert und ziemlich pleite aber voller Gschenkli-Übergabe-Euphorie stehst du vor mir und überreichst mir das Schuhkarton-grosse Geschenk mit der grellfarbenen Verpackung, dem Schnörkel und dem Kleber des Logos des teuren Pop-up-Stores.
Meine Emotionen: «Uh, Gschenkli, was wohl da drin sein mag?»
Ich mache mich – jede Handbewegung unter deiner erwartungsvollen Beobachtung – daran, das Geschenk auszupacken. Doch als mich der japanische Roboter aus den 80ern zum selber Zusammensetzen mit seinem starren Robotergrinsen herausfordernd ansieht, weicht die von meiner Neugierde und deiner Grosszügigkeit induzierten Freude einem Unbehagen.
Folgende Gedanken jagen mir in diesem Moment durch den Kopf:
- «Was zur Hölle soll ich genau mit diesem Gerät?»
- «Ich versuche, seit zwei Jahren so wenig zu besitzen wie möglich und du machst mir einen Strich durch die Rechnung!»
- «Aber eigentlich ist es ja superlieb von dir, dass du mir etwas schenkst und dein Gehirnschmalz und dein Geld dafür geopfert hast. Na super, jetzt stürze ich in ein Dilemma!»
Selbstverständlich sage ich diese Dinge nicht. Stattdessen setze ich diese Mimik auf, die man aufsetzt, wenn man sich genötigt fühlt, Wertschätzung zu zeigen, einem aber gar nicht danach ist.
Ich dopple natürlich noch nach mit der Vorgaukelei und sage Dinge, wie:
«Oh, wow, vielen Dank dir!», in der Hoffnung, dass meine Enttäuschung nicht durchdrückt.

Spätestens dann merkst du aber, dass ich nicht 37 Jahre meines Lebens auf dieses Geschenk gewartet habe, wie du ursprünglich gedacht hast.
Und jetzt bist du enttäuscht. Während des ganzen Prozederes höre ich links und rechts von mir Aussagen wie: «Diese selbst gestrickte, braungrüne Decke mit den orangen Fransen hab ich mir schon immer gewünscht», und bin überrascht, dass meine Grosstante so ungeschminkt und gut lügen kann.
Irgendein Geschenk muss her
Zugegeben: Ich will nicht der Loser sein, der mit leeren Taschen am Weihnachtsfest erscheint, da verfängt der Gruppenzwang bei mir.
Ich bringe also allen eine kleine Wertschätzung mit. Meistens in Form von Champagner oder Schokolade. Sonderlich kreativ ist das nicht, ich weiss.
Aber ich wette, dass bis jetzt jede Moët & Chandon-Flasche getrunken und jede Läderach-Schokolade gegessen wurde, die ich verschenkt habe.
Ein perfektes Geschenk
Der Zeitpunkt für das perfekte Geschenk ist nicht Weihnachten, es ist auch nicht Geburtstag.
Der Zeitpunkt für das perfekte Geschenk ist immer – 365 Tage im Jahr.
Vor zwei Jahren holte mich mein Vater von der Arbeit ab und wir fuhren zusammen in seinem Saab ins Waldhaus Sils, weil wir im Waldhaus in Sils überwintern, weil mein Vater unermesslich reich ist und ich eigentlich gar nicht arbeiten müsste, weil wir uns gemeinsam ein Wochenende im Waldhaus leisteten.
Auf der Höhe von Sargans sagte er zu mir: «Schau mal hinter deinen Sessel, da liegt was für dich». Ich griff also mit der linken Hand nach hinten und ertastete etwas, das sich wie eine kleine Tasche anfühlte. Mit verrenkten Körper zog ich meinen Fund nach vorne und legte ihn auf meinen Schoss.
Es war eine Spiegelreflexkamera. Ich wollte schon länger eine Spiegelreflexkamera, konnte aber nie das nötige Budget aufbringen. Deswegen bat ich regelmässig meinen Vater, ihm seine Kamera auszuleihen. Er wusste, dass ich sie brauchen konnte. Als er ein Angebot sah, hat er an mich gedacht, zugeschlagen und mir damit eine grosse Freude bereitet.

Die Kamera ist mein Begleiter, egal ob in den Ferien oder wenn ich durch Zürich oder Basel spaziere.
Materielles? Zeitverschwendung!
Es gibt Lucky Shots, wie die oben erwähnte Kamera. Aber in der Regel landen Geschenke im Estrich, Keller oder auf Ricardo.
Wieso zur Hölle schenken wir uns überhaupt so viel Materielles? Wir können uns ja eh schon alles auf Knopfdruck online bestellen? Und wir beklagen uns doch andauern, dass wir «endlich wieder mal ausmisten müssten».
Das grösste Geschenk ist Zeit – alleine oder zusammen.
Und die wird uns genommen, weil durch die Schenkerei noch mehr Mist anfällt, den wir dann entsorgen müssen.
Wir können zeigen, dass wir uns gern haben, ohne grosse Geschenke, die wir uns aus den Fingern saugen müssen. Lieber weniger Geschenke und dafür zum richtigen Zeitpunkt.
Und dieser Zeitpunkt ist immer.
Gastblogger Lorenz König macht Marketing bei wemakeit und Musik in Bars. Seine Gedanken zum Gang der Welten veröffentlicht er hier auf eyeblogyou und auf seinem Blog Boom-Town, sag hallo auf Facebook oder Instagram.